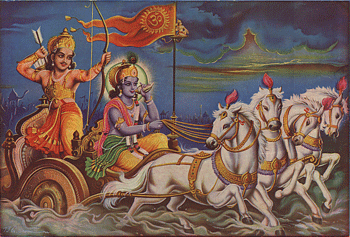| Home | Bilder und Beschreibungen | Begleitbroschüre | Schwesteraustellung: "Rāmāyaṇa" |
| Kṛṣṇa und das Mahābhārata | Zum Inhalt des Mahābhārata | Genealogie | Zur Geschichte der indischen Farbdrucke |
| Ravi Varma | Zur Sammlung und zum Sammler | Druckbeschriftungen | Literatur |
Kṛṣṇa und das Mahābhārata
Erzählungen von außergewöhnlichen Heldentaten, in die beizeiten auch Übernatürliches mithineinspielt, lassen sich in Indien bis in die vedische Literatur zurückverfolgen. In regelmäßigen Abständen wurden diese Geschichten z.B. anläßlich der Vorfeiern zu den großen Pferdeopfern erzählt, die sich über ein ganzes Jahr erstrecken konnten. Lautenspieler begleiteten die Rezitation in metrisch gebundener Sprache und es bildeten sich mit den Barden (sūta) eine soziale Klasse, die den Balladenschatz von Generation zu Generation weitergab, die eine jede das ihre dazu tat, bis die Gedächtnisleistung eines Einzelnen nicht mehr ausreichte und die Überlieferung Stück um Stück verschriftlicht wurde. Die umfangreichste Sammlung dieser epischen Dichtungen ist das Mahābhārata, das über viele vor- und nachchristliche Jahrhunderte hindurch von einem ursprünglichen Kern alter Heldenlieder zu einem Text von heute über 75.000 Strophen in Sanskrit angewachsen ist. Die Hauptgeschichte des Epos, die große Erzählung/der große Kampf der Nachkommen Bharatas, stellt den einen Schwerpunkt der Ausstellung dar (Bilder 2 bis 13).Der andere Schwerpunkt liegt auf Kṛṣṇa. Auch Kṛṣṇa tritt im Mahābhārata als einer der Proponenten der Haupterzählung auf: Er ist Anführer des Clans der Yādavas, ein Bundesgenosse der einen von zwei kriegsführenden Parteien, der sich als guter Berater und geschickter Stratege und schließlich auch als entschlossener Kämpfer hervortut und damit verdient, in einem Heldenepos unter den Ersten genannt zu werden. Doch dieser Kṛṣṇa ist nicht nur eine Figur, die neben anderen auf ein unabwendbar tragisches Ende zusteuert, sondern an einem dramatischen Höhepunkt gibt er sich als Autor und Regisseur der Tragödie zu erkennen: Er offenbart sich seinem Freund Arjuna als eine Manifestation des allerhöchsten Gottes Viṣṇu, der irdische Gestalt angenommen hat, um die Welt vor noch Schlimmerem zu bewahren als sich mit der bevorstehenden Schlacht von Kurukṣetra gerade anbahnt.
Das Titelbild der Ausstellung versucht die Augenblicke einzufangen, die der Offenbarung der Bhagavadgītā vorangehen, nämlich dem ersten Morgen der Schlacht. Arjuna läßt hier seinen Wagenlenker Kṛṣṇa, den er zu diesem Zeitpunkt lediglich für einen guten Freund und Verbündeten hält, den Fluß Hiraṇyavatī überqueren, hinter dem die Pāṇḍavas ihre Angriffslinie formiert haben. Das von den Hufen der Pferde aufgewirbelte Wasser des Flusses scheint sich mit dem Staub zu mischen, der sich als ein unheilvolles Vorzeichen über die Ebene von Kurukṣetra gelegt hat:
saṃdhyāṃ tiṣṭhatsu sainyeṣu sūryasyodayanaṃ prati
prāvāt sapṛṣato vāyur ... rajaś coddhūyamānaṃ tu
tamasāc chādayaj jagat papāta mahatī colkā
prāṅmukhī ... udyantaṃ sūryam āhatya vyaśīryata mahāsvanā
„Während der Dämmerung, als die Soldaten den Sonnenaufgang erwarteten, erhob sich ein mit Regen vermischter Wind ... Und Staub wurde aufgewirbelt und hüllte die Welt ins Dunkel. Und es fiel ein großer, östlich orientierter Meteor, schlug in der aufgehenden Sonne ein und zersplitterte mit lautem Krachen.“
(Mahābhārata VI 19.36-39)
Der zuversichtliche Gesichtsausdruck der beiden Gefährten scheint sich über den bedrohlichen Hintergrund hinwegzusetzen. Man weiß nicht recht, warum. Weil Krieger ihrem ersehnten Ende, dem Tod in der Schlacht, entgegensehen? Oder vielmehr, weil – wie der Betrachter weiß – die Verkündigung der Bhagavadgītā unmittelbar bevorsteht?
Arjuna wird in der Folge den von Kṛṣṇa gelenkten Streitwagen zwischen den beiden Heeren anhalten lassen. Er sieht in beiden Schlachtreihen Verwandte und Freunde, Väter und Großväter, Lehrer, Oheime und Brüder, Söhne und Enkel, Freunde. Für gewöhnlich zieht Arjuna für diese Menschen in den Kampf, jetzt aber soll er sie töten. Davor weicht er zurück und empfindet tiefstes Mitleid. Arjuna gerät angesichts der ausweglosen Situation in einen Konflikt, den er nicht lösen kann: Ist es besser, zu siegen oder sich besiegen zu lassen? An diesem Punkt setzen philosophisch-theologische Erörterungen Kṛṣṇas ein, die darauf hinauslaufen, daß ein Klagen über das bevorstehende Morden grundlos wäre, da der Mensch seinem eigentlichen Wesen nach ewig und unvernichtbar sei. Die Pflicht (dharma) des Kriegers (kṣatriya) wäre es nun eimal, auch zu töten. Ohne hier auf weitere Einzelheiten eingehen zu können, sei auf eine zentrale ethische Grundlehre der Bhagavadgītā hingewiesen:
matkarmakṛn matparamo madbhaktaḥ saṅgavarjitaḥ |
nirvairaḥ sarvabhūteṣu yaḥ sa mām eti pāṇḍava |
„Wisse Nachkomme Pāṇḍus: Wer alle meine Werke um meinetwillen tut, wer mir ganz ergeben ist, wer mich liebt, vom Haften am Irdischen frei und ohne Hass gegen irgendein Wesen ist, der geht zu mir ein.“ (Bhagavadgītā 11.55)
Die Übersetzung stammt von MORIZ WINTERNITZ, einem bedeutenden Historiker der indischen Literaturgeschichte. Er hat über die Bhagavadgītā gesagt: „Nicht die Gedankentiefe, nicht die unergründliche Weisheit, die nach Ansicht der meisten indischen und so vieler europäischer Gelehrten in dieser Dichtung stecken soll, ist es, was die Bhagavadgītā sowohl in Indien als auch in Europa so berühmt und beliebt gemacht hat; sondern ihr dichterischer Gehalt – die Gewalt der Sprache, die Pracht der Bilder und Vergleiche, der Hauch des Weihe- und Stimmungsvollen, der über die Dichtung ausgebreitet ist – sie haben zu allen Zeiten auf empfängliche Gemüter einen so tiefen Eindruck gemacht.“
Die Bhagavadgītā ist das bekannteste und berühmteste Buch der indischen Literatur und dürfte das in Indien am häufigsten gelesene Buch sein. Durch die englische Übersetzung von CH. WILKINS, veröffentlicht 1785, wurde das Werk auch in Europa bekannt. AUGUST WILHELM VON SCHLEGEL hat eine erste kritische Textausgabe mit lateinischer Übersetzung herausgegeben. WILHELM VON HUMBOLDT hat durch diese Übersetzung den Text kennen und schätzen gelernt. Frühe Übersetzungen ins Deutsche wurden von RICHARD GARBE und PAUL DEUSSEN veröffentlicht, unter den neueren Übersetzungen ist die Ausgabe von PETER SCHREINER zu nennen. Durch den Text der Bhagavadgītā wurden dem Mahābhārata kṛṣṇaitische Züge eingeprägt. Es ist ungewiß, wann die Bhagavadgītā mit der Haupthandlung des Mahābhārata verknüpft und in einer gemeinsamen Überlieferung tradiert wurde (als Zeitraum für die Übernahme kommt die Zeit zwischen 100 und 400 unserer Zeitrechung in Frage), es läßt sich aber zeigen, daß die Popularität des Gottes Kṛṣṇa in der Volksreligion Indiens dazu geführt hat, daß auch die ältere Hauptgeschichte des Mahābhārata im Sinne des Kṛṣṇaismus erweitert wurde. (Ein Beispiel ist etwa die Szene in Bild 5 der Ausstellung, in der eine Demütigung Draupadīs durch das verborgene Eingreifen Kṛṣṇas verhindert wird.) Die Modifikation – aus der Perspektive des Gläubigen, hätte man hier von „Richtigstellung“ zu sprechen - kann bis in ein kleines, kaum merkliches Detail gehen, indem durch die Änderung weniger Worte an einem ursprünglich unabhänig überlieferten Textstück mit einem Male Kṛṣṇa für den glücklichen Ausgang eines Abenteuers, für eine überzeugende Belehrung verantwortlich gemacht wird. Eine Analogie im visuellen Bereich zeigt sich etwa in Bild 3 der Ausstellung, auf dem Kṛṣṇas göttliche Persönlichkeit – lange vor ihrer Offenbarung – im Strahlenkranz um seinen Kopf hervorschimmert; und wer wollte bestreiten, daß die Präsenz Kṛṣṇas zumindest einen förderlichen, wenn nicht gar den entscheidenden Einfluß auf Arjunas Schuß gehabt hätte?)
Neben den kleineren Veränderungen, gibt es große Ergänzungen des Mahābhārata vonseiten des Kṛṣṇaismus/Viṣṇuismus. Die umfangreichste ist der Harivaṃśa (der „Stammbaum Haris“, d.h. Viṣṇus/Kṛṣṇas). Dieser wird zwar nur als „Anhang“ oder „Nachtrag“ (khila) bezeichnet, ist mit über 16.000 Doppelversen aber doch recht umfangreich. Neben Schöpfungsberichten und Genealogien im ersten Buch, sind im zweiten Buch insbesondere die Lehre von Viṣṇus irdischen Manifestationen (siehe Bild 1 der Ausstellung) hervorzuheben, sowie die Legenden um Kṛṣṇa-Gopāla, der als Hirtenjunge am Leben und Lieben einer ländlichen Bevölkerung Anteil hat (siehe Bilder 16 bis 36 der Ausstellung). Diese Erzählungen, die im Bhāgavatapurāṇa ihre klassische Form gefunden haben, sind mit der epischen Dichtung nur noch über das gemeinsame Versmaß verbunden. Sie gehören bereits einer anderen Literaturgattung an, in der nicht mehr Helden im Mittelpunkt stehen, sondern ein Gott, der unsere einfachen Sehnsüchte und Sorgen kennt.
dvibhujo gopaveṣaś ca svayaṃ rādhāpatiḥ śiśuḥ |
gopālair gopikābhiś ca sahitaḥ kāmadhenubhiḥ ||
„Mit zwei Armen und in Hirtenkleidern bin ich, der Herr der Rādhā, selbst ein Kind, vereint mit den Hirten und Hirtinnen und mit den alle Wünsche erfüllenden Kühen.“
(Brahmavaivartapurāṇa IV 126.87)
Zum Inhalt des Mahābhārata
Erstes Buch: Ādiparvan (Buch vom Anfang)Als Verfasser des Mahābhārata und zugleich als Verwandter der Hauptakteure des Mahābhārata gilt Vyāsa. Er ist der Sohn des großen Asketen Parāśara und der Nymphe Satyavatī, die später die Ehefrau des Kuru-Königs Śāntanu wird. Um diese Verbindung seines Vaters zu ermöglichen, verzichtet dessen erstgeborener Sohn Bhīṣma freiwillig auf den Thron und legt ein Keuschheitsgelübde ab. Satyāvatī gebiert dem Śāntanu zwei Söhne, die kinderlos sterben. Der jüngere von ihnen hinterläßt jedoch zwei Frauen, welche Vyāsa auf Wunsch seiner Mutter Satyavatī schwängert. Da er aber von äußerst häßlicher Gestalt ist und einen üblen Geruch hat, schließt eine der beiden Frauen beim Beischlaf die Augen, während die andere erbleicht. Deshalb wird der Sohn der ersten, der spätere König Dhṛtarāṣṭra, blind geboren. Die zweite Frau bringt einen Sohn von bleicher Hautfarbe zur Welt, der deshalb Pāṇḍu, der Bleiche, genannt wird. Er ist der spätere Vater der Pāṇḍavas, jenem Geschlecht, das aus der großen Schlacht siegreich hervorgehen wird.
Da Dhṛtarāṣṭra blind ist, wird sein jüngerer Bruder Pāṇḍu König. Dhṛtarāṣṭra heiratet Gāndhārī und zeugt mit ihr hundert Söhne, deren ältester Duryodhana heißt. Pāṇḍu wiederum nimmt zwei Frauen, Kuntī und Mādrī. Mit Kuntī hat er drei Söhne, Yudhiṣṭhira, Arjuna und Bhīma, mit Mādrī die Zwillinge Nakula und Sahadeva.
Nach dem Tode Pāṇḍus wird Dhṛtarāṣṭra trotz seiner Blindheit König und die Pāṇḍavas ziehen mit ihrer Mutter Kuntī – Mādrī ist ihrem Mann in den Tod gefolgt – an den Hof Dhṛtarāṣṭras nach Hastināpura, wo sie gemeinsam mit den Kauravas erzogen werden. Zu den Lehrern der Knaben gehören die waffenkundigen Brahmanen Kṛpa und Droṇa. Der Sohn des Droṇa, Aśvatthāman, und Karṇa, der Sohn eines Wagenlenkers, wachsen ebenfalls mit ihnen am Hof auf.
Die Pāṇḍavas übertreffen die Kauravas an Kraft und Tüchtigkeit, was die Eifersucht der letzteren hervorruft; nur Karṇa ist dem Pāṇḍava Arjuna in allem ebenbürtig. Als Karṇa Arjuna zu einem Zweikampf herausfordert, verschmähen ihn die Pāṇḍavas wegen seiner niedrigen Herkunft.
Der alternde Dhṛtarāṣṭra setzt den Pāṇḍava Yudhiṣṭhira als Thronfolger ein. Doch als sich die Pāṇḍavas durch immer neue Heldentaten hervortun, läßt er sich von seinen eifersüchtigen Söhnen – allen voran Duryodhana – zu einem Mordanschlag auf seine Neffen überreden. Der Plan wird rechtzeitig verraten, so daß die Pāṇḍavas zusammen mit ihrer Mutter entkommen können; die Kauravas halten sie aber für tot. Die Pāṇḍavas streifen nun hauslos in den Wäldern umher und gelangen nach langer Wanderung und Vollbringung zahlreicher Heldentaten schließlich in das Reich des Königs Drupada, wo gerade eine Gattenwahl (svayaṃvara) für seine Tochter Draupadī veranstaltet wird. Auch Karṇa ist anwesend und eben im Begriff, die an die Brautwerber gestellte Aufgabe, das Spannen eines mächtigen Bogens, zu erfüllen. Draupadī weist ihn aber als den Sohn eines Wagenlenkers ob seiner niedrigen Herkunft zu¬rück. Daraufhin tritt Arjuna vor, spannt den Bogen und erhält in der Folge Draupadī zur Frau. Arjuna beschließt, daß Draupadī die gemeinsame Gattin aller fünf Brüder werden solle.
Da die Pāṇḍavas nun mächtige Verbündete gewonnen hatten, beschließen die Kauravas, ihnen das halbe Königreich abzutreten. Die Pāṇḍavas lassen daraufhin in ihrer neuen Hauptstadt Indraprastha einen großartigen Palast erbauen, bei dessen Besichtigung dem Duryodhana allerlei peinliche Mißgeschicke widerfahren.
Zweites Buch: Sabhāparvan (Buch der Versammlung)
Śakuni, ein Meister im Würfelspiel und Onkel des Duryodhana, schlägt diesem vor, Yudhiṣṭhira zu einem Würfelspiel einzuladen. Im Laufe des verhängnisvollen Spiels vespielt Yudhiṣṭhira nach und nach alles, einschließlich seiner selbst, seiner Brüder und zuletzt auch seiner Gattin Draupadī. Sie wird nun herbei geschleppt und von Duḥśāsana, dem jüngeren Bruder des Duryodhana, vor den Augen der ganzen Versammlung gedemütigt, bis Bhīma schwört, ihm die Brust aufzureißen und sein Blut zu trinken. Alle Anwesenden sind entsetzt, aber der blinde Dhṛtarāṣṭra greift schlichtend ein. Draupadī und die Brüder des Yudhiṣṭhira erhalten daraufhin die Freiheit und ihr halbes Königreich zurück.
Aus Angst vor der Rache der Pāṇḍavas überreden die Kauravas Yudhiṣṭhira noch auf dem Heimweg zu einem neuen Würfelspiel, dessen Verlierer zwölf Jahre in die Verbannung gehen und danach ein weiteres Jahr unerkannt unter den Menschen weilen soll; sollte er jedoch erkannt werden, soll er abermals für zwölf Jahre verbannt werden.
Erneut unterliegt Yudhiṣṭhira im Würfelspiel und die fünf Brüder müssen gemeinsam mit ihrer Gemahlin Draupadī in die Verbannung gehen.
Drittes und viertes Buch
Das dritte Buch, der Āraṇyaka- oder Vanaparvan (Buch der Wildnis / des Waldes), beinhaltet die zahlreichen Abenteuer der Pāṇḍavas während ihrer zwölfjährigen Verbannung.
Das viertes Buch, der Virāṭaparvan (Buch des Virāṭa), erzählt, wie sich die Pāṇḍavas im dreizehnten Jahr nach dem verhängnisvollen zweiten Würfelspiel unerkannt am Hofe des Königs Virāṭa verdingen. Nachdem sie für diesen so manche heldenhafte Tat vollbracht haben, geben sie sich schließlich, als das Jahr um ist, zu erkennen. Der Sohn des Arjuna, Abhimanyu, heiratet Virāṭas Tochter.
Fünftes Buch: Udyogaparvan (Buch der Aufrüstung)
Die Kauravas, allen voran Duryodhana, sind nicht bereit, den Pāṇḍavas nach dem Ende der Verbannungszeit die ihnen rechtmäßig zustehende Hälfte des Reiches abzutreten. Beide Seiten treffen in der Folge Kriegsvorbereitungen. Der Ruf des greisen Königs Dhṛtarāṣṭra nach Versöhnung findet kein Gehör.
Kuntī, die Mutter der Pāṇḍavas, will Karṇa für die Seite ihrer Söhne gewinnen und eröffnet ihm, daß er in Wahrheit ihr Sohn sei, den sie einst vom Sonnengott Sūrya empfangen und nach seiner Geburt ausgesetzt habe. Von einem Wagenlenker sei er gefunden und aufgezogen worden. Doch trotz dieser Enthüllung weigert sich Karṇa, seine Freundschaft mit Duryodhana zu verraten. Da Kuntī ihm keine gute Mutter gewesen sei, möchte er sich nicht als ihren Sohn betrachten.
Sechstes Buch: Bhīṣmaparvan (Buch des Bhīṣma)
Es kommt zum unvermeidlichen Krieg zwischen den Pāṇḍavas und den Kauravas und beide Armeen ziehen zum Kurukṣetra („Feld des Kuru“) in eine Schlacht, die achtzehn Tage dauern soll. Als die Heere einander kampfbereit gegenüberstehen, überkommt Arjuna tiefe Trauer ob der vielen Verwandten und einstigen Lehrer, die er im gegnerischen Heer ausmacht. Er sieht sich außer Stande, den Kampf zu beginnen. In einer poetischen Rede, die unter dem Titel Bhagavadgītā („Gesang des Erhabenen“) einen herausragenden Platz innerhalb der indischen religiös-philosophischen Literatur erlangt hat, ermahnt Kṛṣṇa, der Wagenlenker Arjunas, diesen zur Erfüllung seiner Pflichten und zum Kampf gegen die Verwandten. Im Verlauf dieser Rede offenbart sich Kṛṣṇa dem Arjuna als der eine höchste Gott Viṣṇu und zeigt sich ihm in seiner wunderbaren Allgestalt.
Viele Helden kommen zu Tode, zuerst Bhīṣma, der verehrte Großonkel der Kauravas und Pāṇḍavas. Durch eine von Kṛṣṇa ersonnene List wird Bhīṣma von einer so großen Zahl von Pfeilen getroffen, daß er auf ihnen wie auf einem Bett zu liegen kommt; nach Verkündung philosophischer Weisheiten an die um ihn stehenden Trauernden stirbt Bhīṣma. Der junge Sohn Arjunas, Abhimanyu, wird von Duḥśāsana getötet. Ghaṭotkaca, ein Sohn Arjunas mit der Riesin Hiḍimbā, wütet im feindlichen Heer, wird aber schließlich von Karṇa getötet.
Siebentes Buch: Droṇaparvan (Buch des Droṇa)
Nach Bhīṣmas Tod übernimmt Droṇa das Oberkommando über das feindliche Heer. Im Zweikampf zwischen Droṇa und Arjuna kann weder der Lehrer noch der Schüler die Oberhand gewinnen. Da ersinnt Kṛṣṇa neuerlich eine List und läßt Droṇa glauben, sein Sohn sei gefallen. Als Droṇa vom Schmerz überwältigt die Waffen sinken läßt, schneidet man dem Fünfundachtzigjährigen den Kopf ab. Bhīma reißt seinem Schwur gemäß dem Duḥśāsana die Brust auf und trinkt sein Blut.
Achtes Buch: Karṇaparvan (Buch des Karṇa)
Nun übernimmt Karṇa den Oberbefehl. Als ein Rad seines Streitwagens im Kampf im weichen Erdboden stecken bleibt und er versucht, den Wagen wieder flottzumachen, tötet Arjuna – erneut auf Rat Kṛṣṇas – den unbewaffneten Karṇa.
Neuntes Buch: Śalyaparvan (Buch des Śalya)
Nach weiteren Kampfhandlungen sind die Kauravas geschlagen; nur mehr drei ihrer Helden leben, unter ihnen Duryodhana, der von Bhīma zu einem Keulenkampf herausgefordert wird. Lange bleibt der Kampf unentschieden, weil Bhīma zwar der stärkere, Duryodhana aber der geschicktere Kämpfer ist. Wieder ersinnt Kṛṣṇa eine List und rät Arjuna, auf seinen Schenkel zu deuten. Als Yudhiṣṭhira im ersten Würfelspiel die gemeinsame Gemahlin der Pāṇḍavas verspielt hatte, hatte nämlich Duryodhana vor Draupadī seinen Schenkel entblößt. Als Bhīma diese Geste sieht, zerschmettert er Duryodhana – gegen den Kriegerethos, der nur Schläge oberhalb der Gürtellinie erlaubt – die Schenkel und bringt ihn zu Tode; die Niederträchtigkeit der List stößt auch in den Reihen der Pāṇḍavas auf heftige Ablehnung.
Zehntes Buch: Sauptikaparvan (Buch über den nächtlichen Überfall)
Nur durch Zufall entgehen die Pāṇḍavas einem Mordanschlag, den Aśvatthāman, einer der letzten Überlebenden der Kauravas, auf die in ihrem Lager schlafenden Krieger ausübt. Vergeblich hatten Aśvatthāmans Kampfgefährten versucht, ihn von diesem Verbrechen abzuhalten. Die Pāṇḍavas selbst, so meint er, hätten längst „die Brücke des Rechts in hundert Stücke zerschlagen“. Auch die fünf Söhne der Draupadī werden meuchlings ermordet.
Elftes bis vierzehntes Buch
Das elfte Buch, der Strīparvan (Buch der Frauen), enthält Schilderungen der Bestattung der Toten sowie der Klagen und Verwünschungen der Frauen und Mütter.
Das zwölfte Buch, der Śāntiparvan (Buch der Ruhe des Gemüts), und das dreizehntes Buch, der Anuśāsanaparvan (Buch der Unterweisungen), enthalten fast ausschließlich philosophische Unterweisungen und Traktate.
Im vierzehnten Buch, dem Āśvamedhikaparvan (Buch über das Pferdeopfer), veranstaltet Yudhiṣṭhira das große Pferdeopfer, um sich von seinen Sünden zu reinigen.
Fünfzehntes bis achtzehntes Buch
Im fünfzehnten Buch, dem Āśramavāsikaparvan (Buch über das Wohnen in der Einsiedelei), beschließen Dhṛtarāṣṭra und seine Frau, die am Hof der Pāṇḍavas noch fünfzehn Jahre in Ehren gelebt hatten, ihr Leben als fromme Einsiedler zu beenden.
Im sechzehnten Buch, dem Mausalaparvan (Buch über den Keulenkampf), wird Kṛṣṇa, der von Dhṛtarāṣṭras Gemahlin Gāndhārī verwunschen worden war, von einem Jäger getötet.
Im siebzehnten Buch, dem Mahāprasthānikaparvan (Buch über den großen Aufbruch), beschließen auch die Pāṇḍavas und Draupadī, ihre letzte Reise anzutreten, und wandern, mit Bastgewändern bekleidet und nur von einem Hund begleitet, zum Himālaya. Sie übersteigen ihn und gelangen zum Götterberg Meru.
Im achtzehnten Buch, dem Svargārohaṇikaparvan (Buch über das Hinaufsteigen zum Himmel), werden die Pāṇḍavas nach einigen Prüfungen durch den Gott Indra in den Himmel aufgenommen.
Genealogie
Im Mahābhārata ist ein schier unüberschaubarer Reichtum an Erzählungen überliefert, die sich um eine Hauptgeschichte ranken. Dieser erzählerische Kern, ein Heldenepos, handelt von den Auseinandersetzungen zwischen den Pāṇḍavas – den fünf Söhnen des Pāṇḍu (siehe Bild 4) – und den Kauravas – den 100 Söhnen von Pāṇḍus Bruder Dhṛtarāṣṭra – um die Herrschaftsnachfolge im Reich von Bharata. Der für den Thron ausersehene älteste Pāṇḍava Yudhiṣṭhira verspielt zunächst die Krone an den ältesten Kaurava Duryodhana (siehe Bild 5), die Pāṇḍavas und ihre Alliierten können aber – nicht zuletzt dank des Beistands von Viṣṇus Manifestation Kṛṣṇa (siehe Bilder 7 bis 10) – die Herrschaft in einer schrecklichen Schlacht zurückgewinnen (siehe Bilder 11 bis 13).Klicken Sie auf das Bild, um eine größere Darstellung dieser aus Van Buitenens Mahābhārata-Übersetzung entnommenen Zeichnung anzusehen.
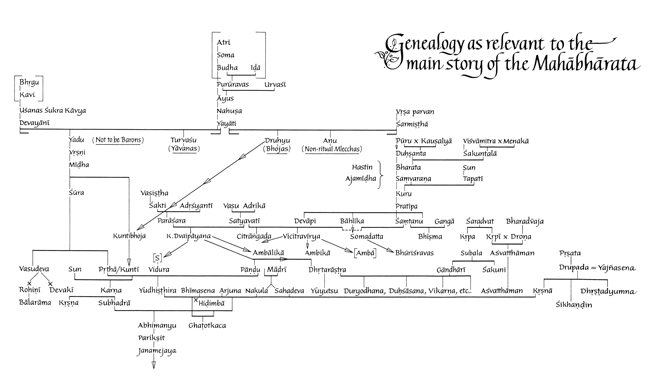
Zur Geschichte der indischen Farbdrucke
Die Darstellung von Göttern, Heiligen und Helden beschäftigt die indische Kunst seit Jahrhunderten. Im ausgehenden 19. Jahrhundert nahm sich auch die lithographische Industrie dieses Gegenstandes an: Nach originalen Kunstwerken wie Zeichnungen und Ölgemälden entstanden Farbendrucke. Die durch Farbigkeit und Unterschiedlichkeit der Stilmittel bestechenden Blätter vermitteln ein Bild indischer Alltagskunst im Spannungsfeld traditioneller Religion und zeitgenössischer Bildsprache. Die in großen Stückzahlen hergestellten Drucke wurden auf Märkten und an Pilgerzentren vertrieben; man schmückte damit Wände oder ergänzte die Ausstattung von Hausaltären. Einst ein erschwingliches Massenprodukt, haben diese Drucke mittlerweile Seltenheitswert.Nachdem Farbendrucke lange Zeit als Trivialkunst gering geachtet wurden, ist ihr Wert als ein Element der Alltagskultur heute weithin anerkannt. Als industriell gefertigte Reproduktionen sind sie wertvolle Zeugnisse für Zeitgeschmack, Bildungsbedürfnis, Mentalität ihrer Käufer oder deren Wohnkultur. Auch Geschichte, Profil und Geschäftsbeziehungen der Herstellerfirmen sowie Entwicklungen der Drucktechnik lassen sich an ihnen ablesen. Farbendrucke stehen am Ende einer Entwicklung indischer Kunst, die oft als „Westernization from below“ bezeichnet wird. Sie beginnt um 1850, als sich indische Maler in Kunstschulen der East India Company europäische Stilmittel und Techniken, darunter Perspektive und Ölmalerei, aneigneten, welche die indische Kunsttradition nicht lehrte.
Die sogenannte „Company Art“, die technisch von Zeichnung, Stich und Aquarellmalerei bestimmt wurde und den Geschmack der Engländer bediente, verlor ab Mitte des 19. Jahrhunderts ihre dominierende Stellung. Im Milieu des indischen Adels und des aufstrebenden Stadtbürgertums entstand nun ein neuer Künstlertyp, der „gentleman artist“, der sich technisch der neoklassizistisch-viktorianischen Ölmalerei und thematisch der indischen Tradition verpflichtet fühlte. Mythologische Sujets wurden in idyllisch-idealen Landschaften theatralisch inszeniert, wobei man dem Betrachter das Gefühl gab, unmittelbar in das Geschehen einbezogen zu sein.
Die neue Bildsprache verlieh der Welt der Götter und Helden die Faszination des zwar Idealen, aber auf einer Zeitebene mit dem Betrachter Existierenden. Dieses Erleben der Götter- und Heldengeschichten wurde noch dadurch verstärkt, daß die meist rührend-gefühlvollen Szenen die Welt der Reichen widerspiegelten. Gleichzeitig wurden die ikonographischen Konventionen streng beachtet. Erstmalig vermittelte die Malerei nun den Reiz der Sanskrit-Kunstdichtung, indem Kunstfertigkeit und Ästhetik der Form Stimmungen erzeugten, die mitzuempfinden für den Betrachter den Gipfel ästhetischen Vergnügens darstellten. Die als nationaler Wert empfundene mythologische Vergangenheit wurde plötzlich in einer visuellen Sprache lebendig, der man nicht mehr den Vorwurf der Primitivität oder des bloß Folkloristischen machen konnte.
Die Farblithographie ermöglichte ab 1880 die Verbreitung der Werke von Künstlern wie B. P. Banerjee und Ravi Varma: Sie betrieben die drucktechnische Vermarktung ihrer Bilder, die sie in eigenen Firmen oder in Deutschland reproduzieren ließen. In der ersten Phase der Unabhängigkeitsbewegung verdankten die Kunstwerke ihre Popularität auch ihrer Vermittlerrolle für nationales Gedankengut. Sie ist auf der Ebene der calender art bis heute ungebrochen.
Quelle: www.uni-leipzig.de/kustodie/ausstellungsarchiv/wunschkuh/index.htm
Ravi Varma
Als in Indien die ersten lithographischen Druckmaschinen eingeführt wurden, führte dies zu einer Überschwemmung des Marktes mit populären Oleographien oder Hochglanzdrucken. Diese wurden für viele indische Künstler zu Prototypen, die sie imitierten, als sie mit der Ölmalerei begannen, die bis dato unbekannt war. Der berühmteste unter ihnen war der Prinz und Künstler Raja Ravi Varma aus Kerala in Südindien. Er war so erfolgreich, daß er eine deutsche Druckerei mit deutscher Technik und Lithographie-Experten, welche die Druckerei betrieben, in der Nähe von Mumbai gründete, um Reproduktionen von Hindu-Göttern und -Göttinnen für die sich damals neu bildende Mittelschicht herzustellen. Diese Drucke wurden so berühmt, daß ihr Einfluß noch bis zum heutigen Tage vor allem in der Volkskunst zu beobachten ist.Die Bilder 14 ("Der Todesgott Yama kommt, um Sāvitrīs Gatten Satyavān zu holen") und 25 ("Kṛṣṇa folgt einer Gopī") dieser Ausstellung stammen aus der Ravi Varma Press.
Raja Ravi Varma (1848-1906) war der erste indische Maler, der Personen und Szenen aus der Welt der Hindu-Epen im Stile des europäischen Realismus darstellte. Er beeinflußte nicht nur Generationen von Künstlern aller Stilrichtungen, sondern selbst Literatur und Filmindustrie bis heute. Daneben war er auch ein äußerst erfolgreicher und dermaßen begehrter Porträtmaler, daß in seinem Heimatort Kilimanoor wegen der zahlreichen Anfragen aus aller Welt eigens ein Postamt eröffnet werden mußte. 1873 gewann er den ersten Preis bei der Malereiausstellung in Madras; zu Weltruhm gelangte er, als er im selben Jahr einen Preis auf der Wiener Weltausstellung errang.
Quelle: www.cyberkerala.com/rajaravivarma
Zur Sammlung und zum Sammler
Dr. Erich Allinger hat seine Sammlung, die an die 1.000 volkstümliche Drucke umfaßt, in den Jahren 1972 – 1999 im Verlaufe von insgesamt 16 mehrwöchigen Indienaufenthalten zusammengetragen, wobei er schließlich vorwiegend Gebiete bereiste, die „westliche“ Touristen kaum aufsuchen. – Obwohl kein Indologe, fesselte ihn die Gedankenwelt der religiösen Taditionen der Hindus, die in den Drucken zutage trat, bald so sehr, daß es ihn reizte, über die Themen und Inhalte der zumeist an Marktständen bei Rahmenhändlern erworbenen Exemplare Klarheit zu gewinnen, was freilich nur möglich war anhand einschlägiger wissenschaftlicher Werke und schließlich von Texten, wie es die beiden großen Epen und die Purāṇas sind. Die hiefür unumgängliche (zumeist englischsprachige) Literatur wurde nur zum kleineren Teil in Indien selbst gekauft, zum größeren von einer Buchhandlung in Delhi auf dem Postweg bezogen, schließlich aber auch in Wiener Bibliotheken ausfindig gemacht. Themenkreise, die sich bald herauskristallisierten, betrafen nicht nur die beiden großen Epen Indiens, das Mahābhārata und das Rāmāyaṇa, Kṛṣṇa und die anderen Viṣṇu-Avatāras, Śiva und Göttinnen wie Durgā und Kālī, sondern auch eine nicht geringe Zahl von teils wohlwollenden, teils strafenden (und so sich Verehrung erzwingenden) „godlings“, mehrheitlich ursprünglich lokale Erscheinungen, die erst im Verlaufe der „Sanskritisierung“ in das Hindu-Pantheon eingegliedert worden sind.Im Herbst 2004 fand eine erste Ausstellung ausgewählter Drucke aus Dr. Allingers Sammlung mit dem Titel "Rāmāyaṇa -- die Farbenpracht der indischen Epik" am Institut für Südasien-, Tibet- und Buddhismuskunde statt, die großen Anklang fand.
Dr. Erich Allinger lebt als Gymnasial-Professor im Ruhestand in Wien, wo er seine Zeit unter anderem auch damit zubringt, die Drucke seiner Sammlung systematisch zu analysieren und die Ergebnisse schriftlich niederzulegen.
Druckbeschriftungen
In untenstehender Liste werden die auf den Drucken gemachten Angaben zur Druckerei und zu Titel und Nummer des Drucks sowie die Künstlersignatur (falls vorhanden) aufgeführt.| Druck No. | Titel | Beschriftung und Signatur |
| 01 | Viṣṇu erhält die Welt | Brijbasi & Sons: ''das avtar'' (Nr. 84), Signatur Rādhakṛṣṇa Śarmā |
| 02 | Bhīṣma gelobt Keuschheit | Brijbasi & Sons: ''bhīṣma pratijñā'' (Nr. 175), Signatur K.P. Suram |
| 03 | Arjuna erlangt Draupadī | H.C. Bhargava & Co, Orginaltitel unleserlich, Signatur Caturbhuj Śarmā |
| 04 | Die Pāṇḍavas und ihre Gattin Draupadī | Brijbasi & Sons: ''pāṇḍava darbār'', Signatur Indra Śarmā |
| 05 | Kṛṣṇa verhindert die Entkleidung Draupadīs | H.C. Bhargava & Co: ''draupadī vastra haraṇa'', Signatur Caturbhuj Śarmā |
| 06 | Bhīma unterwegs, eine Demütigung Draupadīs zu rächen | Ravi Varma Press: ''vallavasairandhrī'', nicht signiert |
| 07 | Der erste Morgen der Schlacht von Kurukṣetra | Sharma Picture Publication: ''kṛṣṇa-arjuna'', Signatur B.G. Sharman |
| 08 | Arjuna legt seine Waffen nieder | Unbekannte Druckerei, kein Titel, nicht signiert |
| 09 | Kṛṣṇa zeigt seine wahre Gestalt | J.B. Khanna & Co: ''Virat Swaroop'' (Nr. 646), Signatur unleserlich |
| 10 | Die kosmische Erscheinung Kṛṣṇas | Jain Picture Publishers: ''Geeta Updesh'' (Nr. 318), Signatur N.L. Sharma |
| 11 | Das Schlachtfeld von Kurukṣetra | Sharma Picture Publication: ''kaurava pāṇḍava saṃgrām'' (Nr. 191), Signatur B.G. Sharman |
| 12 | Kṛṣṇa greift in den Kampf ein | S.S. Brijbasi & Sons: ''Sudarshan Chakra'', Signatur Sopan Bros |
| 13 | Arjuna tötet Karṇa | S.S. Brijbasi & Sons: ''karṇa-arjun yuddh'' (Nr. 221), Signatur K.P. Suram |
| 14 | Der Todesgott Yama kommt, um Sāvitrīs Gatten Satyavān zu holen | Ravi Varma F.A.L. Press: ''sāvitrī'', Signatur Ravi Varma |
| 15 | Sāvitrī gewinnt den toten Satyavān zurück | Sharma Picture Publication: ''satyavān sāvitrī'' (Nr. 217), Signatur B.G. Sharman |
| 16 | Kṛṣṇalīlā - Kṛṣṇas göttliches Spiel | S.S. Brijbasi & Sons: ''Shri Krishna Leela'' (Nr. 132), Signatur Rāmacandra (?) |
| 17 | Kṛṣṇas Geburt im Kerker | Jain Picture Publishers: ''Krishna Janam'' (Nr. 180), nicht signiert |
| 18 | Vasudeva flieht mit Kṛṣṇa durch den Fluß Yamunā | Sharma Picture Publication: ''vasudev gaman'', Signatur B.G. Sharman |
| 19 | Kṛṣṇa stibizt Süßigkeiten | Sharma Picture Publication: ''bāl mukund'', Signatur B.G. Sharman |
| 20 | Kṛṣṇa und Balarāma werden beim Butterstehlen ertappt | Unbekannte Druckerei: ''Krishna, Balram and Gopi'', nicht signiert |
| 21 | Kṛṣṇa besiegt den Schlangenkönig Kāliya | Sharma Picture Publication: ''kāliya daman'', Signatur B.G. Sharman |
| 22 | Kṛṣṇa hütet eine Rinderherde | Unbekannte Druckerei, kein Titel, Signatur N.L. Sharma |
| 23 | Kṛṣṇa hebt den Berg Govardhana empor | S.S. Brijbasi & Sons: ''Goverdhan Leela'', nicht signiert |
| 24 | Kṛṣṇa entwendet die Kleider der badenden Gopīs | R.U. & V. Press: ''gopī vastraharaṇ'' (Nr. 246), nicht signiert |
| 25 | Kṛṣṇa folgt einer Gopī | Ravi Varma Press: ''bansīdhar'' (Nr. 81), Signatur Ravi Varma |
| 26 | Eine Gopī lauscht Kṛṣṇas Flötenspiel | Unbekannte Druckerei: ''baṃsrī kī tān'', Signatur Indra Śarmā |
| 27 | Kṛṣṇa mit Rādhā und weiteren Gopīs beim Holī-Fest | Sharma Picture Publication: ''rādhā kṛṣṇa holī'' (Nr. 250), Signatur B.G. Sharman |
| 28 | Rāsalīlā | Sharma Picture Publication, kein Titel, Signatur G.I (?) Sharma |
| 29 | Das Paar Rādhā und Kṛṣṇa | S.S. Brijbasi & Sons: ''Sri Radha Krishnan'', nicht signiert |
| 30 | Rādhā und Kṛṣṇa während des Monsuns auf einer Schaukel | Sharma Picture Publication: ''rādhā kṛṣṇa jhulā'', Signatur B.G. Sharman |
| 31 | Rādhā und Kṛṣṇa in tänzerischer Pose | Arora Bros: ''Radha Krishnan'', nicht signiert |
| 32 | Rādhā und Kṛṣṇa als Manifestationen der Verehrung | S.S. Brijbasi & Sons: ''śrī rādhā mādhav'', Signatur Sopan Bros |
| 33 | Kṛṣṇas Weggang nach Mathurā | Unbekannte Druckerei, kein Titel, Signatur K.P. Sivam |
| 34 | Karte von Braj mit Szenen aus Kṛṣṇas Leben | Pramoda Print: ''braj caurāsī kos kā citr'', nicht signiert |
| 35 | Kṛṣṇa zieht mit seinem Flötenspiel die Natur in seinen Bann | Unbekannte Druckerei, kein Titel, Signatur unleserlich |
| 36 | Die Kuh als Symbol der Erfüllung aller Wünsche | J.B. Khanna & Co: ''Radha Krishna'' (Nr. 730), Signatur L.N. Sharma |